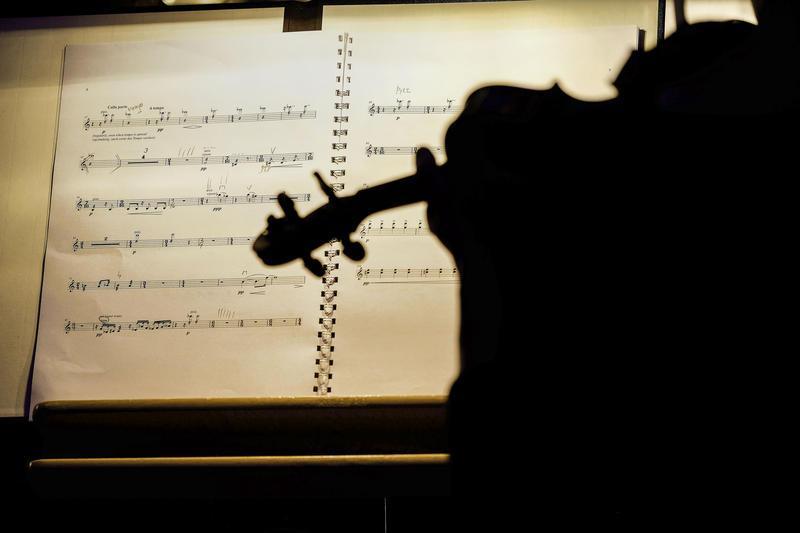
Ein Klavierstück so lang wie ein Tag. Der französische Komponist Erik Satie (1866-1925) hat es in seinem Werk „Vexations“ genau so notiert: Ganze 840 Mal soll die immer gleiche Klaviersequenz hintereinander gespielt werden. Das dauert in der Regel zwischen 19 und 22 Stunden. Damit ist „Vexations“ („Quälereien“) eines der längsten Musikstücke überhaupt und eines der ersten Beispiele für ein repetitives Arrangement sowie für Atonalität in der Kunstmusik.
Als humorvoller und skurriler Eigenbrötler steht Satie für außergewöhnliche Ideen. Er war ein Pionier: Sein experimentelles Schaffen gilt sogar als Vorreiter der Minimal Music. Am 1. Juli jährt sich Saties Todestag zum 100. Mal.
Der Pianist Igor Levit sorgte im Jubiläumsjahr für Aufmerksamkeit, als er die „Vexations“ in London in einem rund 13-stündigen Konzert spielte. Im Mai sind sie auch in der europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz aufgeführt worden: Fünf Pianistinnen und Pianisten stellten sich im Industriemuseum der Herausforderung. Jeder und jede spielte 168 Mal die gleiche Tonfolge.
Einer von ihnen ist der Dresdner Musiker Torsten Reitz. „Die ersten drei Stunden waren total gut“, erzählt er im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd). Aber danach sei es „über den Wohlfühlbereich hinausgegangen“. Das Stück erfordere eine gewisse Demut.
Ähnlich sieht es die Leipziger Pianistin Mrika Sefa: Am Anfang habe sie jeder Wiederholung etwas Besonderes geben wollen: „Ich wollte Abwechslung schaffen und mich gegen das Gefühl des Déjà-vu stemmen.“ Doch „als ich die Wiederholung einfach so annahm, wie sie ist - ein bisschen mühsam - wurde mir klar, dass keine Wiederholung genau gleich ist.“
Satie hat vor allem Klavierstücke geschrieben, aber auch Chansons sowie Werke für Orchester und Chor. Zeitweise lebte der am 17. Mai 1866 in Honfleur im nordfranzösischen Departement Calvados geborene Komponist im Künstlerviertel Montmartre in Paris. Sein Geld verdiente er unter anderem als Klavierspieler im Kabarett „Le chat noir“, einem Treffpunkt der Pariser Bohème. Eine Zeit lang war er mit der Malerin Suzanne Valadon liiert.
Er war das älteste von vier Kindern eines Franzosen und einer Schottin. Mit 13 Jahren begann er ein Musikstudium in Paris, das er jedoch bald schon abbrach. Er arbeitete quasi als Autodidakt weiter. Erst mit 40 Jahren nahm er wieder ein musikalisches Studium auf.
Satie hatte einen ausgeprägten Sinn für Absurdes, Ironisches und Spielerisches. Seine Werktitel wie „Vertrocknete Embryonen“, „Drei Stücke in Form einer Birne“ oder „Melodien zum Davonlaufen“ wirken wie kleine Provokationen gegen den Ernst der sogenannten Hochkultur. „Wahrhaft schlaffe Präludien für einen Hund“ - das kann auch als Kommentar zur doch eher steifen Etikette der Musiktradition verstanden werden.
Die Musik der späten Romantik in ihrer Opulenz und den immer größer werdenden Besetzungen - das war wohl der Antrieb für Satie, in seiner Musik radikal zu reduzieren. Er bevorzugte einfache Harmonien, klare Melodien, wenig emotionale Entwicklung - alles stets mit einem Augenzwinkern.
Vielen seiner Stücke sind skurril-unverständliche Texte und Vortragsanweisungen beigegeben: „Ziemlich blau. Dreimal genau hinsehen. Nicht zu gierig. Ohne mit der Wimper zu zucken. Zum Lutschen. Wie eine Nachtigall mit Zahnschmerzen.“
Zeitlebens verband den Franzosen, der gern schlichte Cordanzüge trug, eine Freundschaft mit Claude Debussy (1862-1918). Auch Maurice Ravel (1875-1937) spielte Saties Werke und machte sie damit bekannt.
Manche sagen, „Vexations“ sei eine sarkastische Abrechnung mit dem Kompositionsunterricht am Pariser Konservatorium und gar nicht zur öffentlichen Präsentation geschrieben worden. Tatsächlich wurde das 1893 komponierte Stück erst Jahrzehnte später, 1963 in New York, uraufgeführt, auf Initiative von John Cage.
„Satie war schon ein Kauz, ironisch und provokativ“, sagt Reitz. Seine große Leistung sei aber, dass er der spätromantischen Opulenz etwas völlig Anderes entgegengesetzt habe - und zwar vollkommen individualistisch. Satie selbst hat einmal gesagt: „Ich bin sehr jung auf eine sehr alte Welt gekommen.“
Der Minimalist bezeichnete sich selbst als Phonometrographen, also als „Klangmesser“. Er soll dazu gesagt haben: „Es macht mir mehr Spaß, einen Ton zu messen, als ihn zu hören.“ Dies sei typisch für dessen Außenseitergeist, findet der Leiter von Chor und Orchester der Bergischen Universität Wuppertal, Christoph Spengler. Statt sich als Komponist mit großem Genie zu stilisieren wie viele seiner Zeitgenossen, habe er eine technisch-nüchterne Grundlage für sein Werk gewählt.
Spengler erklärt: „Er empfand sich als jemand, der seiner Zeit voraus war, aber sich gleichzeitig von der Welt, in die er hineingeboren wurde, entfremdet fühlte.“ Bis zuletzt lebte Satie in Armut in einem Pariser Vorort.

