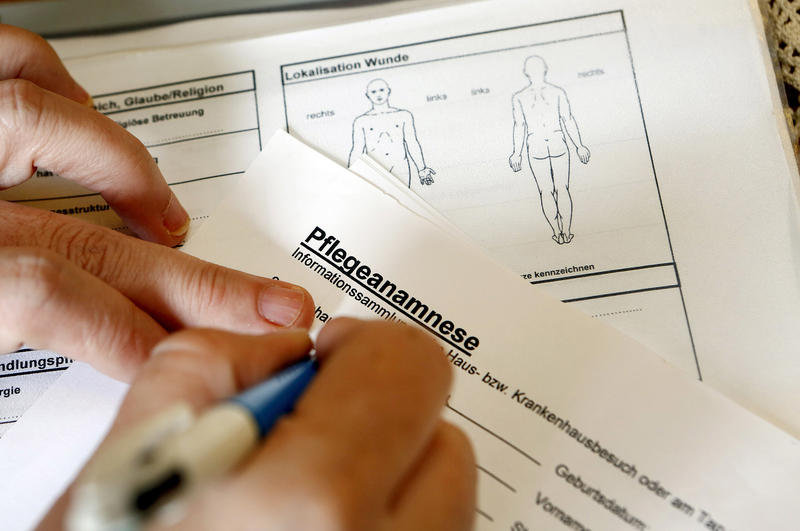
In Kliniken und Heimen wird nicht nur gepflegt. Was immer auch getan wird, muss dokumentiert werden. Seit Jahren klagen Pflegekräfte über zu viel Bürokratie, doch die wird nicht weniger. Viele Fachkräfte kehren entnervt dem Job den Rücken.
Berlin (epd). Mit der „Strukturierten Informationssammlung“ (SIS) wurde zwar vor zehn Jahren in der Pflege eine entbürokratisierte Dokumentation eingeführt. Doch noch immer frisst die „Doku“ viel Zeit im Pflegealltag auf. Das führt zu Frust bei den Pflegeprofis - ein Faktor, der mit dazu beiträgt, dass Pflegekräfte aus dem Beruf aussteigen. Einer, der es wissen muss, ist Intensivkrankenpfleger Benjamin Lutze: „Wir befassen uns mit dem Falschen.“ Er hat der Pflegeberuf an den Nagel gehängt.
Lutze hat in mehreren Kliniken gearbeitet. Zuletzt in Frankfurt am Main, bevor er Ende 2024 aus der Pflege ausstieg. Fast überall, sagt er, wird doppelt oder dreifach dokumentiert. Dieselben Beatmungsparameter zum Beispiel können im Beatmungsprotokoll, in der Tageskurve und im Freitext der Standarddokumentation festgehalten werden - um sich nach allen Seiten abzusichern. Er selbst dokumentierte stets „präzise und knapp“. Was immer wieder zu Konflikten mit Kollegen oder Vorgesetzten führte: „Ständig musste ich mich rechtfertigen“, berichtet Lutze.
Lange Liste an zu erfassenden Daten
Pflegekräfte stehen schon aus Zeitmangel ständig vor der Frage: „Mache ich etwas, um Vorgaben zu erfüllen, oder tue oder unterlasse ich etwas im Sinne des Betreuten?“ Ein täglicher Konflikt, der nachvollziehbar wird, wenn man weiß, was in Heimen alles festgehalten werden muss - und diese Liste ist nicht vollständig: persönliche Stammdaten des Bewohners, Pflegeanamnese samt Erfassung der individuellen Pflegebedürfnisse, spezielle Gewohnheiten, soziale Beziehungen und aktuelle Befindlichkeiten, Ziele und Maßnahmen der Pflegeplanung, tägliche Berichte zu erledigten Arbeiten, individuelle Beobachtungen, Besonderheiten und Veränderungen samt Datum, Uhrzeit und Unterschrift der Pflegekraft sowie Schmerzprotokolle, Wunddokumentation und Medikamentenplanung.
Dokumentationen sollten Lutze zufolge ausschließlich der Patientensicherheit dienen. Soweit die Theorie. In der Praxis werde jedoch viel aus Unsicherheit dokumentiert. Um abgesichert zu sein, falls etwas schiefgeht. Damit werde die Sache absurd: Unter zeitaufwendigen Dokumentationen leiden laut Lutze nämlich jene Personen, für die dokumentiert werden soll.
Bürokratie nimmt in anderen Bereichen zu
Durch die entbürokratisierte Dokumentation muss laut Frank Weidner heute zwar weniger als vor zehn Jahren dokumentiert werden. Allerdings gelte das nur für die reine Pflege, sagte der Pflegeforscher und Vorstand des Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung dem Evangelischen Pressedienst (epd). Daneben gebe es weitere Berichtspflichten: „Zum internen Qualitätsmanagement, zum Datenschutz und Hygienekonzepten oder für Krisenkonzepte und das Beschwerdemanagement.“
In der Summe habe der Aufwand eher zugenommen. Doch egal, ob mal etwas mehr oder etwas weniger zu dokumentieren ist: „Die Dokumentation muss oft für den grundsätzlichen und häufig berechtigten Unmut in der Pflege wegen schlechter Rahmen- und Arbeitsbedingungen herhalten.“
Ulrich Dobler, Pressesprecher des Altenhilfeträgers „Stiftung Liebenau“ in Meckenbeuren (Bodenseekreis), sagt, der hohe Bürokratieaufwand könne ein Grund für „schlechte Pflege“ sein. Und er betont, dass aus der Dokumentation die Qualität der Betreuung nicht zwangsläufig ersichtlich sei, weil sie nicht sämtliche Arbeiten am Bett vollständig abbilden könne. Er verweist zudem auf ein Phänomen, das viele Heime beklagen: Doppelte Prüfung gleicher Tatbestände durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen und die kommunale Heimaufsicht: „Das wirft oft Fragen auf und führt zu Unsicherheit.“
Ständige Angst, in Haftung genommen zu werden
Pflegefachkraft Heike Arens aus Fulda betont, durch die Angst, in Haftung genommen zu werden, dehne sich die Dokumentation immer weiter aus. Deshalb werde in Heimen beispielsweise so viel rund um Prophylaxe schriftlich festgehalten. Denn: Bekomme ein Patient einen Dekubitus, könne über die Dokumentation nachgewiesen werden, dass pflegerisch alles versucht wurde, um ein Wundliegen zu verhindern.
Arens, die vor eineinhalb Jahren aus der Pflege aus- und in die Pflegeberatung einstieg, empfand die Dokumentationspflichten in der ambulanten Pflege als weitgehend sinnvoll. Anders stelle sich die Situation in der Tagespflege dar: „Ich musste dort genauso viel dokumentieren wie im stationären Bereich, dabei sind die Leute oft nur einmal in der Woche anwesend.“ Als freigestellte Praxisanleiterin in verschiedenen Pflegeheimen kam sie zu der Erkenntnis: Auch dort, wo Dokumentation an sich sinnvoll ist, wird Pflege nach ihrer Beobachtung nicht unbedingt besser.
Sandra Postel, Präsidentin der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen, hört immer wieder von Pflegekräften, dass Dokumentationen häufig nicht für die Patienten, sondern für die Prüfdienste geschrieben würden. Und nicht selten würden „pflegerische Binsenweisheiten festgehalten“. Fehlten die entsprechenden Sätze in den Dokumenten, werde das bei Prüfungen gerügt. Nach der Devise „sicher ist sicher“ werde oft doppelt dokumentiert.
Wichtige Zeit für die Pflege fehlt
Postel nennt die Situation paradox: „Die Dokumentation nimmt so viel Zeit in Anspruch, dass weniger Zeit für die direkte Pflege bleibt und die Bewohner nicht ordentlich versorgt werden können.“ Statt nur Dokumentationen zu prüfen, sollten Prüfer mit Bewohnern sprechen und den Ablauf im Heim beobachten.
Kathrin Mangold vom Bundesverband Ambulante Dienste und Stationäre Einrichtungen: „Der Grundsatz: ‚Was nicht dokumentiert ist, ist nicht gemacht‘, gilt schon lange nicht mehr, er wird aber noch von vielen Pflegekräften gelebt.“ Fachkräften müsse diese Angst genommen werden, fordert sie. Aber: „Die Dokumentationsprüfung durch die Heimaufsichten hat in vielen Bundesländern immer noch einen großen Stellenwert.“
Der Verband sieht in der Künstlichen Intelligenz (KI) Chancen, effektiver zu arbeiten und genauer zu dokumentieren: „Tools zur Spracherkennung, die viele Sprachen problemlos verstehen, machen Dokumentationen leichter.“ Die diktierten Inhalte könnten direkt an der richtigen Stelle abgespeichert werden. Auch sei es möglich, digital erhobene Vitaldaten direkt zu übernehmen.
Wie hilfreich KI bei der Dokumentation ist, wird gerade am Deutschen Institut für angewandte Pflegeforschung analysiert. Noch stoßen KI-Modelle schnell an ihre Grenzen, berichtet Forscher Frank Weidner. Sie benötigten, um gut sein zu können, einen Grundstock an vergleichbarer Systematik etwa in der Feststellung von Pflegebedarfen. Pflegediagnosen könnten die Basis dafür bilden: „Die sind in Deutschland aber nicht eingeführt.“

