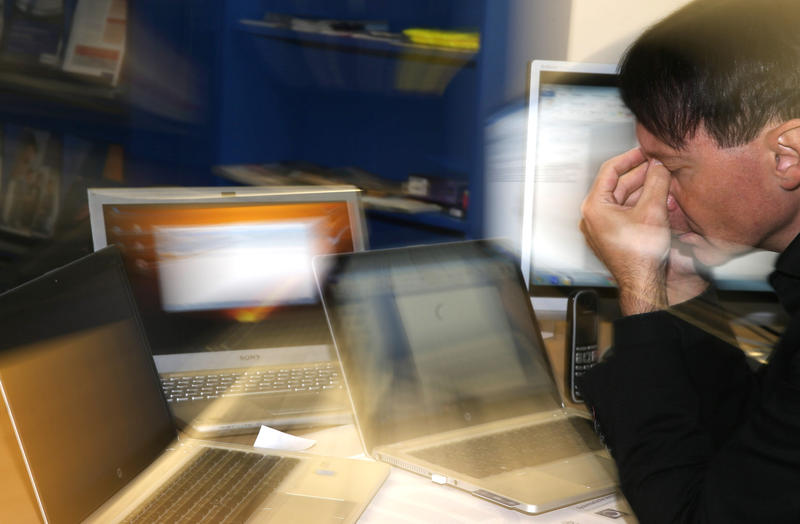
Mehr als jeder zehnte Arbeitnehmer in Deutschland leistet Mehrarbeit. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, haben im vergangenen Jahr 4,4 Millionen Beschäftigte durchschnittlich mehr gearbeitet als in ihren Arbeitsverträgen vereinbart war. Das entsprach einem Anteil von elf Prozent der insgesamt 39,1 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Dabei machen Männer mit einem Anteil von 13 Prozent etwas häufiger Überstunden als Frauen (10 Prozent).
Deutliche Unterschiede zeigen sich mit Blick auf die einzelnen Wirtschaftsbereiche. Am weitesten verbreitet war Mehrarbeit in den Bereichen Finanz- und Versicherungsleistungen sowie Energieversorgung, wo 17 Prozent beziehungsweise 16 Prozent der Beschäftigten davon betroffen waren. Am niedrigsten war der Anteil mit 6 Prozent im Gastgewerbe.
Die Daten basieren auf den Erstergebnissen der Arbeitskräfteerhebung des Mikrozensus für das Jahr 2024. Demnach war für die meisten Beschäftigten der Umfang der Mehrarbeit auf wenige Stunden pro Woche begrenzt. 45 Prozent gaben an, durchschnittlich weniger als fünf Überstunden geleistet zu haben. Bei insgesamt 73 Prozent waren es weniger als zehn Stunden. Allerdings leisteten 15 Prozent der Betroffenen mindestens 15 Stunden Mehrarbeit in der Woche.
Mehrarbeit kann in Form von bezahlten und unbezahlten Überstunden geleistet werden oder auf ein Arbeitszeitkonto einfließen, über das sie später wieder ausgeglichen werden kann. Von den Personen, die 2024 mehr gearbeitet hatten als vertraglich vereinbart, leistete knapp jede Fünfte (19 Prozent) unbezahlte Überstunden. 16 Prozent wurden für ihre Überstunden bezahlt. 71 Prozent nutzten ein Arbeitszeitkonto für die geleistete Mehrarbeit.
Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung lehnte vor diesem Hintergrund eine Änderung der täglichen Höchstarbeitszeit ab. Institutsdirektorin Bettina Kohlrausch kritisierte, Arbeitgeber wendeten sich gegen die tägliche Höchstarbeitszeit und wollten sie durch eine wöchentliche Obergrenze ersetzen. „Damit könnten Beschäftigte in die Lage kommen, bis zu 12 Stunden am Tag zu arbeiten, obwohl - das zeigen die Daten - schon heute viele Beschäftigte Mehrarbeit leisten“, sagte Kohlrausch.
Sie unterstrich, „dass bereits jetzt viele Ausnahmen von der täglichen Höchstarbeitszeit möglich sind“. Die Institutsdirektorin begrüßte einen im Laufe des Tages beginnenden Dialog der Sozialpartner über das Thema Arbeitszeiten. „Dabei sollte es allerdings nicht, wie vor allem von den Arbeitgebern gefordert, um eine Deregulierung von Arbeitszeiten gehen, sondern um eine Stärkung der Arbeitszeitsouveränität von Beschäftigten“, forderte Kohlrausch.

